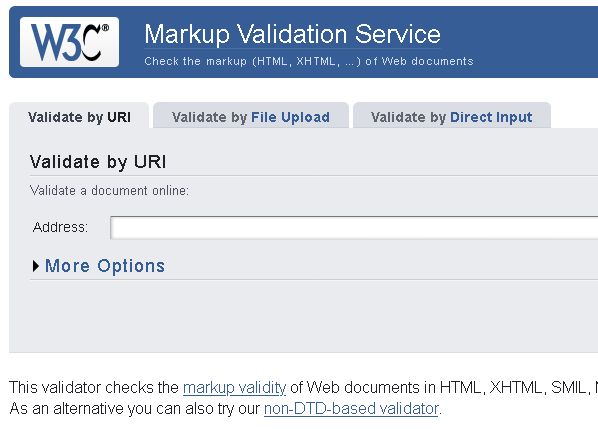Die Förderung der digitalen Barrierefreiheit ist wichtig, um sicherzustellen, dass Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Inhalten und Technologien haben.
Eine effektive Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, eine „Community of Practice“ (CoP) für digitale Barrierefreiheit aufzubauen. Eine CoP ist eine Gruppe von Menschen, die sich auf freiwilliger Basis zusammenschließen, um Wissen und Erfahrungen zu teilen, Probleme zu lösen und bewährte Praktiken zu entwickeln. In diesem Beitrag werden Schritte und Prinzipien für den Aufbau einer solchen Gemeinschaft erläutert.
Was ist eine CoP?
Eine CoP ist eine Plattform für den informellen Austausch von Ideen und Ressourcen sowie für die Zusammenarbeit zur Verbesserung der digitalen Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen. Es ist außerdem ein Beratungs-Gremium, welches Fragen diskutieren kann, die über die reinen Barrierefreiheits-Richtlinien hinaus gehen.
Sie kann aus behinderten Menschen und aus interessierten Personen bestehen. Dabei ist es sinnvoll dass die Beteiligten ein Interesse an dem haben, für das sie Beratung übernehmen.
Dabei sollte man die Ressourcen zum Aufbau und zur Organisation einer solchen Gruppe nicht unterschätzen: Jemand muss die Personen finden, zusammenbringen, bei der Stange halten, sie informieren, Sitzungen organisieren und moderieren und vieles mehr.
Nutzen einer CoP
Die folgenden Vorteile kann eine Community of Practice haben:
Wissensaustausch: Eine CoP bietet eine Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und bewährten Praktiken im Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Mitglieder können von den Erkenntnissen und Herausforderungen anderer profitieren.
Lernen und Schulung: Die CoP ermöglicht kontinuierliches Lernen und Schulung in Bezug auf digitale Barrierefreiheit. Mitglieder können von Experten lernen und ihr Wissen aktualisieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Bewusstseinsbildung: Die CoP kann dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der digitalen Barrierefreiheit zu schärfen. Dies kann dazu beitragen, dass mehr Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen und Maßnahmen ergreifen.
Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit innerhalb der CoP kann dazu beitragen, gemeinsame Projekte und Initiativen zur Verbesserung der digitalen Barrierefreiheit zu starten. Gemeinsame Anstrengungen können zu besseren Ergebnissen führen.
Netzwerken: Die CoP bietet die Möglichkeit, wertvolle berufliche Kontakte zu knüpfen. Dies kann hilfreich sein, um Fachleute und Organisationen zu identifizieren, die an ähnlichen Themen arbeiten.
Qualitätskontrolle: Die CoP kann dazu beitragen, Qualitätsstandards und Richtlinien für digitale Barrierefreiheit zu entwickeln und zu fördern. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass digitale Inhalte für alle zugänglich sind.
Unterstützung und Beratung: Mitglieder der CoP können sich gegenseitig bei Herausforderungen im Zusammenhang mit digitaler Barrierefreiheit unterstützen und beraten. Dies kann dazu beitragen, Probleme effektiv zu lösen.
Innovation: Durch den Austausch von Ideen und Erfahrungen können innovative Ansätze zur digitalen Barrierefreiheit entwickelt werden. Dies kann dazu beitragen, neue Lösungen und Technologien zu fördern.
Einflussnahme: Eine gut vernetzte CoP kann Einfluss auf politische Entscheidungsträger, Unternehmen und andere Akteure ausüben, um die Bedeutung der digitalen Barrierefreiheit zu unterstreichen und Veränderungen herbeizuführen.
Identifizieren Sie die Zielgruppe
Der erste Schritt beim Aufbau einer CoP für digitale Barrierefreiheit besteht darin, die Zielgruppe zu identifizieren. Das können Fachleute, Entwicklerinnen, Designerinnen, Content-Erstellerinnen und andere sein, die an digitaler Barrierefreiheit interessiert sind. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Mitglieder ein gemeinsames Interesse an diesem Thema haben.
Definieren Sie die Ziele und Zwecke:
Klare Ziele und Zwecke sind entscheidend für den Erfolg einer CoP. Die Ziele könnten sein, bewährte Praktiken zu entwickeln, Wissen zu teilen, Schulungen anzubieten oder digitale Barrieren zu identifizieren und zu beseitigen.
Schaffen Sie eine Plattform für die Kommunikation:
Eine effektive Kommunikationsplattform ist von entscheidender Bedeutung. Das kann ein Online-Forum, eine Mailingliste, soziale Medien oder regelmäßige Treffen in Person oder per Videokonferenz sein. Die Plattform sollte den Mitgliedern die Möglichkeit bieten, Ideen, Fragen und Ressourcen auszutauschen.
Identifizieren Sie Experten und Ressourcen
Innerhalb der CoP sollten Experten und Ressourcen identifiziert werden, die zur Verfügung stehen, um Mitgliedern bei der Lösung von Problemen und der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten zu helfen. Dies können externe Experten, Schulungsmaterialien, Forschungsergebnisse oder bewährte Praktiken sein.
Förderung der Teilnahme:
Die Beteiligung der Mitglieder ist entscheidend. Sie sollte aktiv gefördert werden, indem interessante Themen, Diskussionen und Aktivitäten angeboten werden. Die CoP sollte ein Ort sein, an dem Mitglieder gerne Zeit verbringen und von anderen lernen.
Sammeln und Teilen von Ressourcen:
Mitglieder sollten ermutigt werden, Ressourcen wie Leitfäden, Checklisten, Tools und Schulungsmaterialien zu sammeln und zu teilen. Dies fördert die Zusammenarbeit und erleichtert den Zugang zu relevanten Informationen.
Etablieren von Best Practices:
Die CoP sollte Best Practices in der digitalen Barrierefreiheit entwickeln und fördern. Dies kann durch die Zusammenarbeit an Projekten, die Prüfung von Websites auf Barrierefreiheit oder die Entwicklung von Richtlinien und Standards geschehen.
Evaluieren und Anpassen:
Die CoP sollte regelmäßig ihre Effektivität evaluieren und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Dies kann durch Umfragen, Feedback der Mitglieder und die Analyse der Aktivitäten und Ergebnisse geschehen.
Messung des Erfolgs:
Der Erfolg der CoP kann anhand von Kriterien wie der Zunahme des Bewusstseins für Barrierefreiheit, der Verbesserung der digitalen Barrierefreiheit von Projekten und der aktiven Beteiligung der Mitglieder gemessen werden.
Vergütung
Wer in einer CoP mitwirkt, sollte ab einem gewissen Level auch eine Vergütung erhalten. Häufig sind es Personen, die arbeiten oder anderweitig beschäftigt sind bzw. finanzielle Hilfe gut gebrauchen können. Man sollte nicht davon ausgehen, dass die CoP immer kostenlos arbeitet. Gleichzeitig muss man auch berücksichtigen, dass die CoP zu organisieren auch Arbeit kostet und entsprechende Ressourcen bereitgestellt werden müssen.
wer sollte eine CoP aufbauen?
Eine CoP ist nur dann sinnvoll, wenn auch entsprechend Bedarf besteht bzw. generiert wird. Sinnvoll kann es etwa für große Behörden oder Kommunen sein. Hier kann und sollte man auch auf Personen aus der Belegschaft bzw. Einwohnende der Kommune zurückgreifen, da hier eine natürliche Verbindung besteht.
Auch große Agenturen, die viel im Bereich Barrierefreiheit/Inklusion arbeiten, können eine CoP aufbauen und deren Leistungen dem Kunden zur Verfügung stellen. Das Problem ist bisher, dass das vom Kunden nicht stark nachgefragt bzw. nicht bezahlt wird.
Erwartungs-Managementt
Als behinderte Person hat man nicht immer den Eindruck, dass die eigene Expertise wertgeschätzt wird. Wir kennen in Deutschland genug Gremien, die ohne behinderte Menschen diskutieren und Entscheidungen treffen. Oder die Beteiligung wird pro forma durchgeführt und die eingebrachten Ideen werden vollständig ignoriert.
Eine CoP kann nur erfolgreich sein, wenn die Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet. Das heißt nicht, dass jede Idee auch umgesetzt werden kann oder muss – das ist oft nicht möglich. Aber zumindest sollte man sich die Mühe machen, die Ablehnung von ideen zu erklären oder Lösungen anzupassen.
Wichtig ist eine effektive Moderation, also eine oder mehrere Personen, welche Diskussionen moderieren und lenken, ohne in einen Ego-Trip zu verfallen. Auch reine „Laber-Gruppen“, also Gruppen, in denen viel gesprochen, aber nichts beschlossen oder praktisch gemacht wird, bringen in der Praxis nicht viel.
 Man sieht es immer wieder: Es wird eine positive Sache genannt und hinten etwas wie „trotz Barrierefreiheit“ drangehängt. Ein paar Beispiele:
Man sieht es immer wieder: Es wird eine positive Sache genannt und hinten etwas wie „trotz Barrierefreiheit“ drangehängt. Ein paar Beispiele: